QCX – ein neuer Monoband- CW-Transceiver als Bausatz
Juli 2017 waren die ersten CW-Transceiver QCX bei QRP Labs erhältlich. Das Interesse an diesen Monobandern ist seitdem weiter gewachsen und Bausätze sind nur nach Wartezeit erhältlich. Der Beitrag beschreibt den Aufbau, die grundlegenden Funktionen und den Abgleich mit Bordmitteln

Hans Summers, G0UPL, der Entwickler des CW-Transceivers QCX, hat in den vergangenen Jahren nicht nur die QRP-Gemeinde mit preiswerten und einfach aufzubauenden Bakenbausätzen beglückt. Sie lassen sich in vielen Sendearten wie WSPR, QRSS-CW, CW, DFCW, FSKCW betreiben. Die Bausätze sind ausgesprochen gut dokumentiert und funktionieren in der Regel auf Anhieb. Auf der Ham Radio 2017 stellte Hans seinen neuen Transceiver QCX persönlich vor.Allein am ersten Tag gingen nach der Ankündigung auf www.qrp-labs.com 320 Bestellungen für den neuen Bausatz ein. Mit Stand Dezember 2017 waren es fast 2500, wobei die letzten dieses Produktionsloses Ende Dezember ausgeliefert wurden.

Bausatzbezug
Der Bausatz ist für 49 US-$ erhältlich. Nach der Anmeldung auf
der oben genannten Website mit Post- und E-Mail-Adresse lässt
sich er sich unter Angabe des gewünschten Bands bestellen.
Entsprechend dem Empfängerland werden noch zusätzlich die
Versandkosten ermittelt und nach Tageskurs in Euro umgerechnet
im Warenkorb angezeigt. Der Betrag von etwa 50 € ist nach
einer Bestätigungs-E-Mail per Paypal zu überweisen. Nach etwa
zwei Wochen trifft ein Päckchen aus Japan ein, das in der
Regel in Deutschland von der Zollabfertigung befreit ist. Auf
www.qrp-labs.com/qcx.html steht ein 138-seitiges Handbuch in
Englisch zum Download bereit. Peter Dressler, DL6DSA,
erstellte dankenswerterweise die deutsche Handbuchübersetzung,
die dort ebenfalls herunterladbar ist. Im Handbuch sind
Bestückung, Inbetriebnahme, Abgleich, Fehlersuche, Funktion
der Schaltung und Menüführung ausführlich beschrieben.
Schaltung

Herzstück des Transceivers ist der Oszillatorschaltkreis
Si5351 von SiLabs [1] mit drei getrennt programmierbaren
Ausgängen. Die komplette Steuerung aller Funktionen erfolgt
mit einem ATmega328. Für den Sendebetrieb steuert der
Prozessor den Oszillator-IC so an, dass er ein Rechtecksignal
mit der Sendefrequenz direkt erzeugt Drei parallelgeschaltete
MOSFETs BS170 bilden die Endstufe im E-Betrieb
(Schalterbetrieb am resonanten LC-Kreis). Von dem
12-V-Rechtecksignal des Generators an den Gate-Anschlüssen der
MOSFETs gelangt nach dem siebenpoligen Tiefpassfilter nur ein
ausreichend sauberes Sinussignal an die Antenne. Die
Empfängerschaltung weist einige der von SDR-Empfängern
bekannten Merkmale auf. Nach dem auch vom Sendezweig genutzten
Tiefpassfilter gelangt das Eingangssignal auf ein
Bandpassfilter. Auf seiner Ausgangsseite stehen zwei gegenüber
Masse um 90° versetzte Signale zur Verfügung. Die beiden zur
Mischung erforderlichen, um 90° versetzten I- und
QOszillatorsignale erzeugt der Si5351 direkt. Dass sich mit
diesem Schaltkreis nicht nur Signale unterschiedlicher
Frequenz, sondern auch mit starrer Phasenverschiebung erzeugen
lassen, war mir bisher neu. Andere Schaltungen gewinnen die um
90° verschobenen I- und Q-Signale aus der vierfachen
Oszillatorfrequenz durch 4:1-Teilung. Der
Analogschalter/Multiplexer FST3253 [2] mischt die Eingangs-
und Oszillatorsignale. Die beiden Mischerausgangssignale
gelangen nach der Verstärkung mittels zweier
Operationsverstärker über zwei 90°-Phasenschiebernetzwerke zu
einem 500-Ω-Einstellwiderstand. Die Signale des gewünschten
Seitenbands werden dort addiert, die des anderen Seitenbands
heben sich bei diesem Prinzip auf. Zu doppelten Signalen, wie
sonst bei einfachen Direktmischempfängern systembedingt
üblich, kommt es hier somit nicht. Die Einstellung des dafür
eingesetzten Spindeleinstellwiderstands ist eine der wenigen
Abgleicharbeiten. Das unerwünschte Seitenband lässt sich um
mehr als 40 dB unterdrücken. Nach der Zusammenführung der
Signale folgen das aktive 200-Hz-CW-Filter und der
NF-Verstärker. An dieser Stelle gelangt auch der vom Prozessor
erzeugte Mithörton in den NF-Zweig.
Aufbau
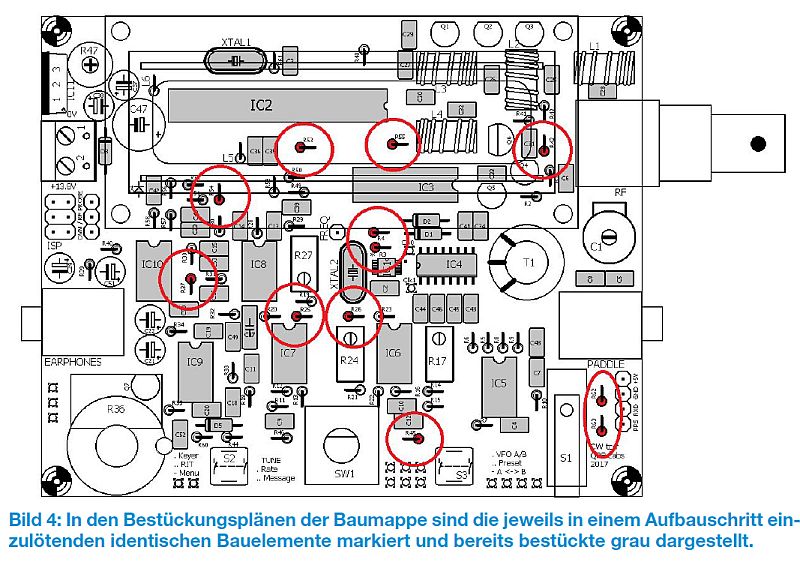
Der Aufbau vieler Bausätze scheitert daran, dass für die Bedienelemente eine Vielzahl von Verbindungsleitungen zu ziehen sind. Viele erfolgreiche Bausätze sind deshalb auf einer einzigen Platine ausgeführt, auf der sich direkt alle Bedienelemente und Anschlüsse befinden. Wer auf ein Gehäuse verzichtet, kann alle Bauelemente auf der Leiterplatte des QCX einlöten und den Transceiver so betreiben. Bis auf zwei Schaltkreise handelt es sich ausschließlich um bedrahtete Bauelemente. Die beiden SMD-ICs (Si5351, FST3253) sind bereits auf der Leiterplatte aufgelötet. Die Bestückung ist für jedes Bauelement mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung auf 60 Seiten grafisch dokumentiert. So sind beispielsweise die Lage aller zwölf Widerstände mit dem Nennwert 1 kΩ im Bestückungsplan rot umrandet, siehe Bild 4. Durch die ausführliche Beschreibung im Handbuch und die Bestückung identischer Bauteile in einem Schritt sind Bestückungsfehler weitgehend ausgeschlossen. Aus meiner Sicht ist nur das Wickeln der Ringkern - spule im Eingangskreis mit vier Einzelwicklungen etwas komplexer. Doch selbst eher ungeübte Bastler können dies durch die bebilderte Wickelanleitung realisieren.
Inbetriebnahme

Ähnlich umfangreich wie der Aufbau sind in der Baumappe die
Inbetriebnahme und die Funktion aller Baugruppen erläutert.
Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung ist zuerst der
Kontrast des LC-Displays einzustellen. Es erscheinen im
Display ein Begrüßungstext und einmalig die Abfrage der
Bandversion. Danach sind vier einfache Abgleichschritte
durchzuführen. Zusätzliche Messmittel sind dabei nicht
erforderlich. Es reichen die auf der Leiterplatte vorhandenen
Komponenten aus: Voltmeter, HF-Leistungsmesser,
Frequenzzähler, Signalgenerator. Ein Beispiel aus der kurzen
Abgleichprozedur: Entsprechend der Anleitung sollte ich den
maximalen Pegel in einem bestimmten Menüpunkt einstellen. Der
betreffende Trimmkondensator des Eingangsbandpassfilters war
jedoch bei meinem Gerät nicht auf das geforderte Maximum
abgleichbar. Der Anzeigewert wurde zwar größer, jedoch selbst
bei geringster Kapazität kein Maximum erreicht. Für diesen
Fall ist in der Abgleichanleitung neben dem Foto Platten
komplett offen in Bild 3 erläutert, dass man einige Windungen
von einer Spule entfernen soll. Danach war dieser
Abgleichschritt ohne Probleme durchführbar. Im Handbuch ist
ebenfalls der Abgleichprozess zur Unterdrückung des
unerwünschten Seitenbands beschrieben – hier bietet eine
Balkenanzeige im LC-Display Unterstützung. Weitere
Abgleichhilfsmittel sind auch hier nicht erforderlich. In
ähnlicher Weise erfolgt der restliche Abgleich.
Gehäuse
Ein fertiges Gehäuse ist für den Bausatz von QRP-Labs nicht
erhältlich und eigentlich für den Betrieb auch nicht
notwendig. Im QRP-Forum stellen einige Funkamateure Varianten
vor, die von Gehäusen aus transparentem Kunststoff,
Aluminiumprofilen bis hin zu solchen aus dem 3-D-Drucker
reichen [3]. Eigene Gehäusekreationen sind einfach zu
verwirklichen. Da für alle Bedienelemente zusätzlich
Lötanschlüsse vorgesehen sind, lassen sich zusätzliche Taster
und Buchsen in der Gehäusefront montiert über kurze Drähte mit
der Grundplatine verbinden, ohne die bereits eingelöteten
Bauelemente entfernen zu müssen. Die Firma BaMaTech
bietet auch Gehäusebausätze an.
Betriebseigenschaften
Ein Vergleich zu dem von mir ebenfalls genutzten Yaesu FT-817
an derselben Antenne zeigt, dass der Empfänger des QCX eine
hohe Empfindlichkeit besitzt. Andreas Lindenau, DL4JAL, hat
seinen QCX durchgemessen und als Ergebnis –123 dBm für die
Grenzempfindlichkeit (engl. Minimal Detectable Signal, MDS) im
QRP-Forum veröffentlicht [3]. Das 200-Hz-CW-Filter fand ich
bei der Suche nach Stationen gewöhnungsbedürftig. Weiterhin
macht sich die fehlende Regelung bemerkbar. Die Menüführung
ist intuitiv. Wer die Einstellungen bei der Inbetriebnahme
vorgenommen hat, kommt schnell damit klar, dass der
Funktionsaufruf über kurze oder lange Betätigungen der Taster
erfolgt. Der eingebaute Morsetaster ist mehr zum Testen als
zum QSOs fahren geeignet. Der abschaltbare CW-Decoder
funktioniert nur bei sauber gegebenen und einwandfrei zu
empfangenen Zeichen. Er lässt sich jedoch auch zur Kontrolle
der eigenen Gebeweise heranziehen.
Testergebnisse
Die vom Hersteller angegebenen 5 W Ausgangsleistung sollen bei
15 V Versorgungsspannung erreichbar sein, bei 13,8 V immerhin
noch 4 W. Bei meinem Transceiver konnte ich bei 13,8 V nur
reichlich 2 W messen. Im Handbuch ist beschrieben, dass die
Induktivitäten der Tiefpassfilterspulen manchmal zu groß sind.
Durch die dann niedrigere Grenzfrequenz kommt es bereits auf
der Arbeitsfrequenz zu einer Dämpfung, die sich durch
schrittweises Abwickeln der Spulen verringern lässt. Im
QRP-Forum berichteten Funkfreunde vom Erfolg dieser Maßnahme.
Dieser Umbau steht bei mir noch aus. Im Sendefall ist die
erste Oberwelle um 53 dB (gemessen mit einem Rigol DSA815-TG)
abgesenkt – ein sehr guter Wert. Bei Direktmischempfängern
gelangt im Empfangsfall ein Teil des Oszillatorsignals über
den Mischer nicht nur in den NFZweig, sondern auch zum
Antennenanschluss. Mit meiner Messtechnik konnte ich noch –54
dBm feststellen. Damit wird die Zielgröße laut
Amateurfunkverordnung von –57 dBm nur knapp verfehlt.
Nützliche Zusatzeigenschaften
Wie bereits kurz angedeutet, stehen auf der Leiterplatte noch einige zusätzliche Funktionen bereit, die die einzelnen Baugruppen und die Firmware des Transceivers schon von Hause aus mitbringen und durch die sich die Inbetriebnahme stark vereinfacht. So ist der Ausgang des variablen Oszillators zugänglich und der Si5351 somit als Testgenerator von 100 Hz bis 200 MHz nutzbar. Weiterhin steht der Zählereingang des Prozessors zur Verfügung, um ausreichend starke Signale mit einer Frequenz bis etwa 8 MHz zu messen. Außerdem ist ein A/D-Umsetzereingang als Spannungsmesser bis 20 V nutzbar. Der gleiche Eingang kommt samt vorgeschalteter Diode und Glättungskondensator als Leistungsmesser mit geringer Genauigkeit zum Einsatz. Die serielle Schnittstelle des Prozessors kann das Signal eines optionalen GPSEmpfängers auswerten, um einen Feinabgleich der VFO-Frequenz vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass der GPS-Empfänger nicht nur die Standortdaten, sondern über einen Ausgang zusätzlich einen Sekundenimpuls (PPS) ausgibt. Weiterhin lässt sich mit dem GPS-Signal die bei der Aussendungen von WSPR-Signalen erforderliche Zeitsynchronisation realisieren.
Fazit
Der Transceiver QCX ist ein gelungener Bausatz, der nicht nur
vom Preis, sondern auch von der Funktion und von der Qualität
des Handbuchs Maßstäbe setzt. Die Empfindlichkeit ist mehr als
ausreichend. In der Regel sind mehr Stationen zu hören, als
letztendlich mit der niedrigen Sendeleistung erreichbar sind.
Und wer keinen großen Wert auf ein Gehäuse legt, der kann die
bestückte Platine unmittelbar nach dem Aufbau einsetzen. Für
den eher rauen Portabeleinsatz sollte die Leiterplatte jedoch
geschützt untergebracht werden.
Literatur
[1] FA-Bauelementeinformation: Si5351A/Si5351B/ Si5351C:
I2C-programmierbare CMOS-Taktgene - ratoren und VCXO.
FUNKAMATEUR 64 (2015) H. 2, S. 173–174
[2] FA-Bauelementeinformation: FST3253/FST3257: Analoge
Multiplexer/Demultiplexer. FUNKAMA - TEUR 56 (2007) H. 2, S.
173–174; H. 4, S. 389
[3] QRP-Forum: QCX – QRP Labs transceiver kit für 49 US-$.
www.qrpforum.de/index.php?page= Thread&threadID=11467
03.04.2018